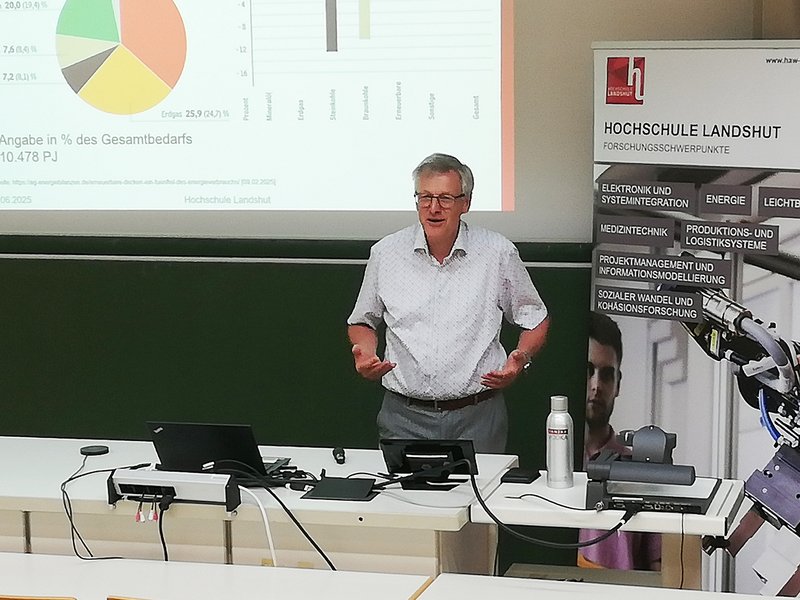Die Landshuter Energiegespräche befassten sich in diesem Semester mit Alternativen und Perspektiven für eine erfolgreiche Energiewende. Passend zum Thema sei es wichtig, eine Bilanz der Energiewende zu ziehen, sich den aktuellen Stand bewusst zu machen und Perspektiven zu zeigen, wie Hochschulvizepräsident Prof. Dr. Marcus Jautze in seiner Begrüßung der rund 100 in Präsenz oder online anwesenden Teilnehmenden erklärte.
Und diese Bilanz zog Prof. Dr. Josef Hofmann (Initiator der Vorlesungsreihe und Sprecher des Forschungsbereichs Energie der Hochschule Landshut) im abschließenden Vortrag der Vorlesungsreihe in diesem Sommersemester. Moderiert wurde die Veranstaltung mit anschließender Diskussion von Prof. Dr. Tim Rödiger (Hochschule Landshut). Die „German Energiewende“ sei mittlerweile auch international ein Begriff. Doch wie er an einer Flasche mit der Aufschrift Vodka verdeutlichte, stelle sich auch bei der Energiewende die Frage, ob das Etikett dem Inhalt entspräche. Fraglich sei auch wie ernst die neue Bundesregierung die Energiewende nehmen wird, die vom diskutierten Sondervermögen in Höhe von 500 Mrd. Euro für die Energiewende aktuell nun Gelder für die fossile Erdgasförderung vor Borkum einzusetzen plane.
Siegeszug der regenerativen Energie
Beim Thema Strom zog Prof. Dr. Hofmann eine überwiegend positive Bilanz der Energiewende: Im Jahr 2024 stammten 62 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien, „wer hätte beim Entschluss zum Ausstieg aus der Atomkraft und der Förderung der erneuerbaren Energien im Jahr 2011 gedacht, dass dies möglich sei,“ fragt Hofmann in die Runde. Die installierte Leistung von Solar und Windenergie-Anlagen habe sich stark erhöht, müsse sich aber in den nächsten Jahren im Zuge der Dekarbonisierung und des wachsenden Strombedarfs noch deutlich steigern.
Betrachte man den grenzüberschreitenden Stromhandel in Europa, so erhalte Deutschland aus Frankreich viel (Atom-) Strom, die großen Lieferanten vor allem für regenerativen Strom sind jedoch mittlerweile Dänemark (Windenergie) und Norwegen (Wasserkraft). Deren Exportlieferungen nach Deutschland übersteigen die Lieferungen aus Frankreich bei weiten. Besonders nach Österreich mit seinen Pumpspeicherkraftwerken werde viel Überschussstrom aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen exportiert, der bei wenig oder keinem Sonnenschein bzw. Wind wieder den Weg über die Grenze findet. Von großer Bedeutung, um das Ziel von möglichst wenig CO2-Ausstoß verfolgen zu können, sei hier u.a. die Nord-Süd-Stromtrasse, um Windkraft & Co aus dem windreichen Norden Deutschlands nutzen zu können, wenn die Sonne in Bayern nicht scheint.
Zu unterscheiden sei bei der Analyse grundsätzlich zwischen Primärenergie, die natürlich vorliegende Energie, und Nutzerenergie, in die sie erst gewandelt werden muss. Dabei komme nur rund ein Drittel beim Verbraucher als zu nutzende Energie an, da der Wirkungsgrad gerade bei fossilen Energieträgern gering sei, bei Dieselfahrzeugen z.B. 25 Prozent. Bei Strom beträgt sie dagegen 85 bis 90 Prozent. Und der Anteil der erneuerbaren Energien sei zwar gestiegen, liege aber nur bei ca. 20 Prozent der Primärenergie, rund drei Viertel stammen aus fossilen Quellen. Positiv sei, dass der Bedarf an Primärenergie in Deutschland vom Jahr 2000 bis heute um rund ein Drittel gesenkt wurde.
Neben dem Stromverbrauch seien auch Wärme im Winter, Kühlung im Sommer und Antriebsenergie für Mobilität wichtige Themen. Der Anteil der Wärme am Energieverbrauch reduzierte sich in den Jahren 2008 bis 2023 um rund 12 Prozent. Der für die Raumwärme nötige Anteil ging dabei nur um rund 3 Prozent zurück. Immer noch würde Heizsysteme zu mehr als zwei Drittel mit Erdgas (46,7 Prozent) und Heizöl (23,4 Prozent) betrieben. Mit der dringend erforderlichen Abkehr von fossilen Energiequellen und Atomstrom und dem verstärkten Einsatz von Wärmepumpen spiele auch hier Strom und damit die regenerativen Energien eine immer wichtigere Rolle. Selbiges gelte auch für den Verkehrssektor, für den eine Abschätzung aber schwierig sei, weil sie sich nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den künftigen Entwicklungen im Batteriebereich richte.
Energiespeicher als Herausforderung und Chance
Der Einsatz von regenerativer Energie bedeute Herausforderungen, aber auch Chancen für den Standort Deutschland. Wind und Sonne seien volatile Energielieferanten, der hohe Ertrag in sonnenreichen Monaten durch PV-Anlagen könne in den Wintermonaten mit Windkraftanlagen kombiniert werden. Allerdings müssten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können, wie die Beispiele des Blackouts in Spanien und Portugal zeigen. Der Netzausbau und Speichersysteme für das Stromnetz zur Frequenz- und Spannungshaltung seien grundlegend.
Batteriesysteme gelten hier als Lösungsansatz für Sekunden- und Minutenreserven, chemische Energiespeicher (Wasserstoff, Methan, Methanol u.a.) für Stundenreserve zur Überbrückung einer Dunkelflaute, den dezentralen Stromnetzaufbau nach einem Blackout und für die Bereitstellung von Kraftstoffen für nicht elektrifizierbare e-Mobilität. Wasserstoff biete einmal durch die Nutzung von überschüssiger Energie zur Erzeugung und dadurch Speicherung von Energie große Möglichkeiten, zusätzlich werde das Potenzial von weißem, in der Erdreich vorhandenem Wasserstoff bisher nicht genutzt.
In seinem Vortrag entkräftete Prof. Dr. Hofmann viele Mythen der Energiewende, das Ziel müsse eine sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Energieversorgung sein. Hierzu sei der verstärkte Einsatz von erneuerbaren Energiequellen unerlässlich. Dabei müsse die Energieeffizienz erhöht werden. Die kostengünstigste Methode sei allerdings Energie zu sparen. Man müsse technikoffen bleiben und Sektoren übergreifend denken. So könne man z.B. die Brennstoffzelle in Fahrzeugen nutzen, um Strom fürs Haus und Wärme zum Heizen zu erzeugen. Die Kopplung von Verkehr und Gebäudetechnik werde bisher viel zu wenig genutzt. So seien beim Vehicle-to-Home Ansatz für die Nutzung von Strom aus batterieelektrischen Fahrzeugen in Gebäuden andere Länder wie beispielsweise Japan weit voraus.
Versorgungssicherheit als Herausforderung
Deutschland könne sich sehr wohl auch ohne Atomkraft mit Strom versorgen: durch PV und Windenergie - allerdings müsse die Nord-Süd-Stromtrasse endlich, am besten mit kostengünstigen überirdischen Leitungen, schnell verwirklicht werden. Ergänzend sollte man auf Geothermie und Biomasse setzen. Speichertechnologien spielen für das Gelingen der Wende eine wichtige Rolle: die Ausstattung im Hausbereich sei stark gestiegen, die Preise gesungen. Auch böten z.B. Erdgasspeicher, die man für Bio-Methan und Wasserstoff nutzen könne, eine zukunftsfähige Alternative, die bisher viel zu wenig genutzt wird.
Für die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und der nötigen Netzfrequenz müsse von zentraler Versorgung vom Top-Down auf das Bottom-Up-Prinzip mit lokalen Netzen umgestellt werden. Die Energiewende bedeute allerdings auch einen Strukturwandel mit wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Der Verzicht auf Kohle führe z.B. in Bergbau-Regionen zum Wegfall von vielen Arbeitsplätzen. Alte Technologien werden verschwinden, neue hinzukommen. Dabei müsse man allerdings Wert darauf legen, dass die Produktion und Wertschöpfung - nicht wie bei den PV-Modulen -, ins Ausland abwandere, wie Hofmann betonte. Er ruft die Anwesenden dazu auf, Teil der Energiewende zu werden. Neben dem eigenen Verhalten und Investitionen und Modernisierung im privaten Bereich, biete gerade die Teilhabe der Bevölkerung durch Bürgerenergiegenossenschaften hierzu eine hervorragende Möglichkeit.